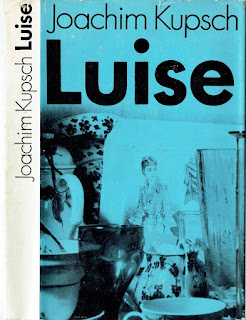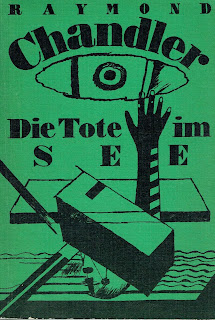Buchanfang:Bunt ist das Kleid der ErdeEtwa 370000 verschiedene Pflanzenarten sind heute bekannt. Mehr als die Hälfte davon, etwa 227000, bilden Blüten, Samen und Früchte, gehören also zu den höheren Pflanzen mit Wurzel, Sproß und Blättern. Im Vergleich dazu nimmt sich die Zahl von 2700 Arten in unserer Heimat recht bescheiden aus. Noch längst ist die Erforschung des Pflanzenreiches nicht abgeschlossen; besonders bei Algen, Pilzen und Flechten werden in jedem Jahr noch zahlreiche neue Arten entdeckt. Doch von diesen niederen Pflanzen soll nur ausnahmsweise die Rede sein. Aus der großen Formenfülle der Pflanzenwelt können hier nur etwa 150 Arten besprochen werden. Aber wie soll die Auswahl aussehen?
Es gibt viel Ungewöhnliches zu berichten, über 135 Meter hohe Mammutbäume in Kalifornien und über Grannen-Kiefern in Nevada, die mit einem Lebensalter von fast 5000 Jahren die wohl ältesten Gehölze der Erde sind. Der Affenbrotbaum Afrikas hat den dicksten Stamm unter allen Gehölzen, und die mit 1 Millimeter Länge kleinste Blütenpflanze, die Zwerg-Wasserlinse, finden wir als Seltenheit auf Tümpeln und Teichen unserer Heimat.
Aber wichtiger sind die weniger ungewöhnlichen Pflanzen, die in großer Menge die Erde bedecken und uns Nahrung und Bauholz, Fasern und andere Rohstoffe liefern. Bei näherem Hinsehen zeigen sie so viele erstaunliche Eigenschaften, daß es schon lohnt, darauf zu achten und sie nach Möglichkeit näher kennenzulernen.
Der Artenreichtum der Pflanzenwelt ist im Verlauf von Jahrmillionen entstanden. Alle Pflanzen und ihre Nachkommen haben ein ganz bestimmtes Aussehen. Aus einer Rose entsteht immer wieder eine Rose; und aus einem Bohnensamen wächst wieder eine Bohnenpflanze und nicht etwa ein Apfelbaum. Von einer Generation zur anderen wird also ein Erbgut übertragen, das unverändert bleibt. Aber das scheint uns nur so. Unser Leben ist viel zu kurz im Vergleich mit der langen Geschichte der Pflanzenwelt. In Wirklichkeit treten im Erbgut durchaus geringfügige Veränderungen auf; aber nur, wenn sich dies in einen auffälligen Merkmal äußert, in Blütenfarbe oder Blattform, werden wir darauf aufmerksam. Solche Mutationen kommen immer nur bei einzelnen Pflanzen vor. Meist verringern sie ihre Wuchskraft ein wenig. Solche Pflanzen gehen zugrunde. Sind die neuen Eigenschaften ohne Bedeutung, so setzen sie sich ebenfalls nicht durch. Nur wenn die Veränderung zufällig einen Vorteil für die Pflanzen bedeutet, vermehren sie sich stärker, nehmen mehr Platz ein und verdrängen die unverändert gebliebenen Ausgangsformen mitunter. Die Umwelt bestimmt also, welche Mutationen erhalten und weiter verstärkt werden, so daß schließlich eine neue Art entsteht.
Während der Erdgeschichte hat sich die Umgebung der Pflanzen oft tiefgreifend verändert. Die Erdoberfläche ist nämlich gar nicht so fest, wie es uns scheint. Wie einem Apfel, der mit der Zeit schrumpft und Falten bekommt, ist es auch unserer Erde ergangen. Ihre Gesteinskruste hat sich immer wieder an bestimmten Stellen gefaltet und emporgewölbt, an anderen Stellen aber abgesenkt. ........
Inhalt: 5 .......... Bunt ist das Kleid der Erde
10 .......... Das Wunderland der Tropen
12 .......... Der Winter ist unbekannt
12 .......... Wo der Pfeffer wächst
13 ..........
Die Baumriesen17 ..........
Lianen, Huckepackpflanzen und Würger21 .......... Vom Wanderackerbau zur Plantagenwirtschaft
23 ..........
Die Bäume26 ..........
Krautige Pflanzen29 .......... Eine Welt auf Stelzen
30 .......... Im Reich des Monsuns
33 .......... Die Savanne
39 .......... Die großen Wüsten
39 .......... Die Gemeinschaft der Dickbäuche
42 .......... Die Gesellschaft der Hageren
43 .......... Die Kurzlebigen
43 .......... Keine Fata Morgana
47 .......... Das Land, wo die Zitronen blühen
47 .......... Die letzten Wälder
51 .......... Die Gebüsche
52 .......... Auch die Macchia wird verwüstet
54 .......... Öl und Wein
59 .......... Wo die Känguruhs leben
61 .......... Am besten ist es zu Hause
61 .......... Unsere Heimat ist ein Waldland
67 .......... Von Kräutern und Gräsern
71 .......... Was wächst auf den Feldern?
75 .......... Die schwarze Erde
75 .......... Die Gesichter der Steppe
79 .......... Weizen, so weit das Auge reicht
81 .......... In der Prärie
83 .......... Das größte Waldgebiet
83 .......... Hundert Grad Temperaturunterschied
84 .......... Die Dunkle Taiga
87 .......... Die Lichte Kiefern-Taiga
88 .......... Die Lärchen-Taiga
89 .......... Kein fester Grund unter den Füßen
93 .......... Das Reich der Lemminge
94 .......... Bäume auf Vorposten
94 .......... Die Zwergstrauch-Tundra
96 .......... Nicht Pilz und nicht Alge
98 .......... Ein unsicheres Gleichgewicht
101 ........ Die großen Gebirge
103 ........ Das Krummholz
104 ........ Die Hochgebirgs-Matten
108 ........ Auf der Alm
110 ........ Schneetälchen
111 ........ Wolkenkratzer-Pflanzen
112 ........ Ein Blick über Europas Grenzen hinaus
117 ........ Das Meer
117 ........ Die Küste
119 ........ Die Wasserwüste
123 ........ Verwalter des Reichtums
127 ........ Sachworterklärungen
131 ........ Artenverzeichnis
Einbandgestaltung: Armin Wohlgemuth
Illustrationen Christiane Gottschlich
Für Leser von 12 Jahren an
Der Kinderbuchverlag, Berlin1. Auflage 1988
2. Auflage 1990