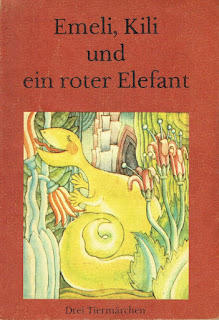Klappentext:
Ein Fischerdorf an der Ostseeküste. Man schreibt das Jahr 1892. Das Leben dort ist wie eingefroren, ein ewiger Kreis – Geburt, Arbeit, Tod. Manch einer hat nicht Zeit, unter dem niedrigen Strohdach seiner Kate zu sterben, weil die See ihn vorher holt. Für die Frau bleibt die Arbeit mit den Kindern und das endlose Warten, wenn draußen der Sturm heult, die bange Frage, ob der Mann heimkehrt. Unter den Männern besteht eine Kameradschaft, über die niemand spricht, die aber ihre ungeschriebenen Gesetze hat. Für den, der die Gesetze übertritt, kommen trübe Tage, für den hat der Mond einen Hof.
In spannungsreicher Handlung, mit Wärme und feinem Humor führt Herbert Nachbar in diese Landschaft. In den Herzen der Menschen leben Leidenschaften und Begierden wie überall, und wie überall lebt die Liebe, wie überall gibt es Tage voller Frohsinn und Glück. Der Autor führt in Höhen und Niederungen des menschlichen Daseins und spürt eindringlich nach den verborgenen Bezirken hinter den Dingen darin liegt der besondere Wert des Romans.
Buchanfang:
ERSTER TEIL
Der Fluß durchzieht mooriges Land. Die Dämme, die ihn halten bei hohem Wasser, sind stellenweise mit Birken bewachsen, mit weißfleckig schimmernden Birken. Das Astwerk ist kahl und braun, grau ist das Gras über den Wurzeln. Der Fluß gurgelt dem Meer zu, dem Bodden. Wasser glitzert im Mond, ist gezeichnet von silbernen Spuren. Der Fluß, der von den Fischern bündig Tümpel genannt wird und eigentlich die Riecka heißt, stinkt. Er kommt von der Stadt und bringt viel Unrat mit, und der moorige Grund wirft Blasen nach oben.
Aber dann passiert er die holländische Holzbrücke, schleicht müde und träge am Dorf vorbei, geht ein in den großen Bodden, verliert so seine Selbständigkeit und ist nichts mehr, ist alles bat mit einemmal die Weite gewonnen, ist stark geworden und mörderisch. Der Mond macht ihn ganz zu Silber und Ebenholz, kein Damm setzt ihm mehr Schranken.
Die Sonne liegt noch weit unter dem Horizont. Im Dorf glänzen frühe Lichter aus den Katen. Die Boote im kleinen Hafen reiben sich manchmal knarrend an den Pollern, an denen sie vertaut liegen. Wasser saugt schmatzend an Planken.
Und im Dorf ist kein Laut. Die Eichen, die vor Martin Bischs Krug seit undenklichen Zeiten stehen, scheinen Geheimnisse zu verbergen, die hölzernen Grabkreuze auf dem alten Friedhof unter der Kirche erzählen von all den vielen, die da waren und gegangen sind, von denen, die gingen und noch da sind. Die Fischer spucken dreimal gegen den Mond, wenn sie unabsichtlich so ein Kreuz oder gar den ganzen Friedhof zu sehen bekommen.
Einbandgestaltung Brigitte N. Kröning
Aufbau-Verlag Berlin und Weimar
1. Auflage 1956
2. Auflage 1959
3. Auflage 1960
4. Auflage 1962
5. Auflage 1965
6. Auflage 1967
7. Auflage 1968
8. Auflage 1969
9. Auflage 1972
10. Auflage 1974
11. Auflage 1975
12. Auflage 1977
13. Auflage 1980
14. Auflage 1982
15. Auflage 1986
............................................................................................................................................................
Verlagstext:
Wilhelm Stresow, der „Bootsmann“, ahnt noch nicht, welche Verwirrungen auf ihn warten, wie eng sein Schicksal sich mit Stines Schicksal verknüpfen wird. Und selbst wenn er etwas ahnte, selbst dann würde er nicht ausweichen. Und so ist er bald mitschuldig an dem Komplott, das Inspektor Bünning und Pastor Winkelmann gegen des Bootsmanns Freunde schmieden. Nichts weltbewegend Böses wollen die beiden, sie sind Menschen wie viele andere auch, und der Bootsmann fügt sich ihnen nicht ungern, als sie ihm Stine Wendland ins Haus geben wollen. Des Bootsmanns Frau ist krank. Inspektor Bünning kann ihm eine Vergünstigung beschaffen, die alle Sorgen für den Bootsmann auslöscht. Ein neues Haus will er bauen, Gemeindevorsteher will er werden – das Leben wird leichter für ihn sein. Aber er hat seine Freunde vergessen; er hat aufgehört, mit ihnen zu rechnen. Stine und alle Vergünstigungen bringen Verwirrung in sein Herz und sein Haus.
Aufbau-Verlag Berlin und Weimar
Reihe: bb-Reihe Bd. 31
1. Auflage 1959
............................................................................................................................................................
Verlag Volk und Welt, Berlin
Reihe: Roman-Zeitung Nr. 97 [Heft 08/1957]
1. Auflage 1957
............................................................................................................................................................
Verlag Kultur und Fortschritt, Berlin
Lizenz d. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar
Reihe: Lesergemeinschaft Buch des Monats
1. Auflage 1958
............................................................................................................................................................
Verlag Tribüne, Berlin
Reihe: Edition Horizonte
1. Auflage 1990